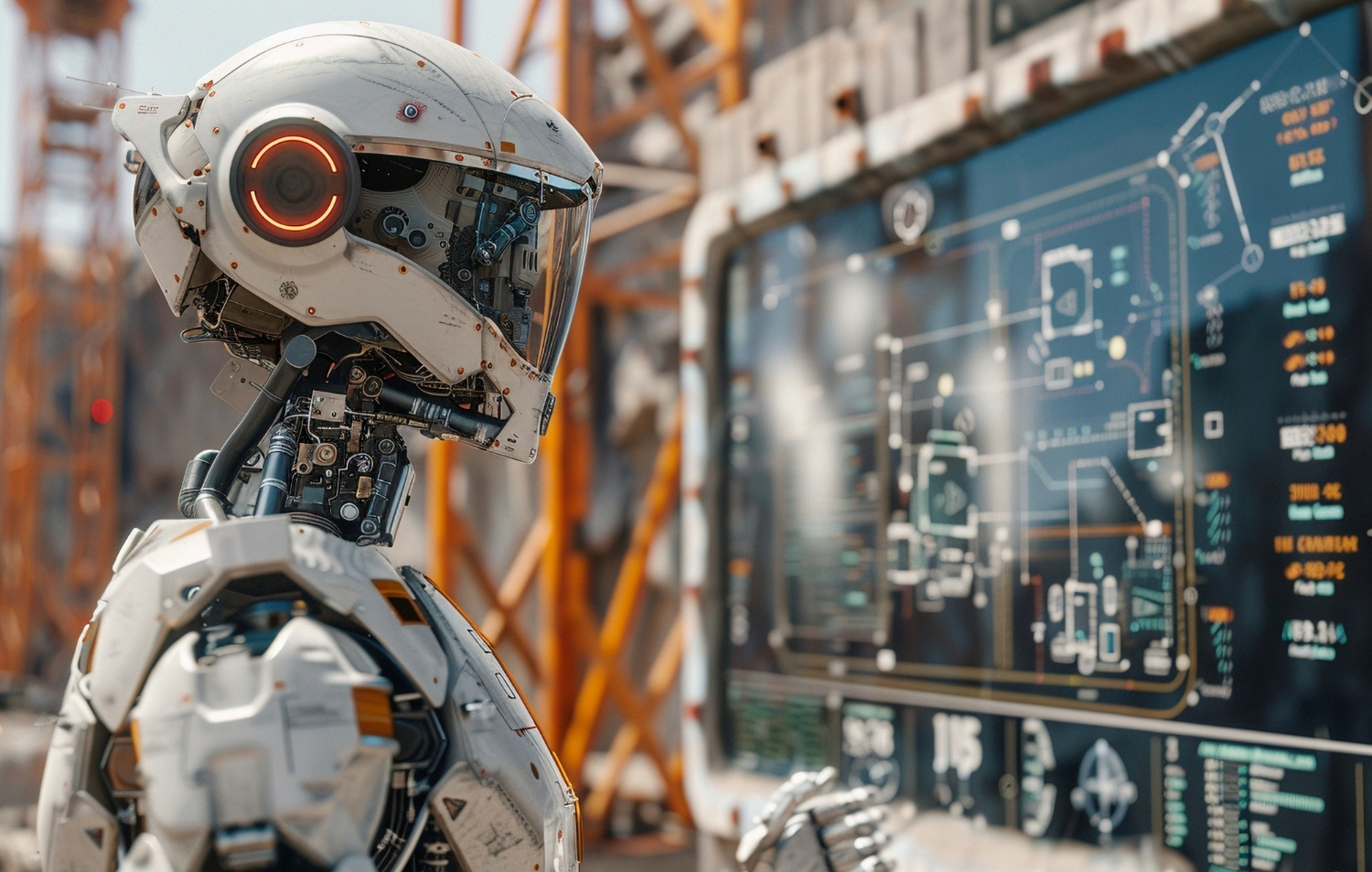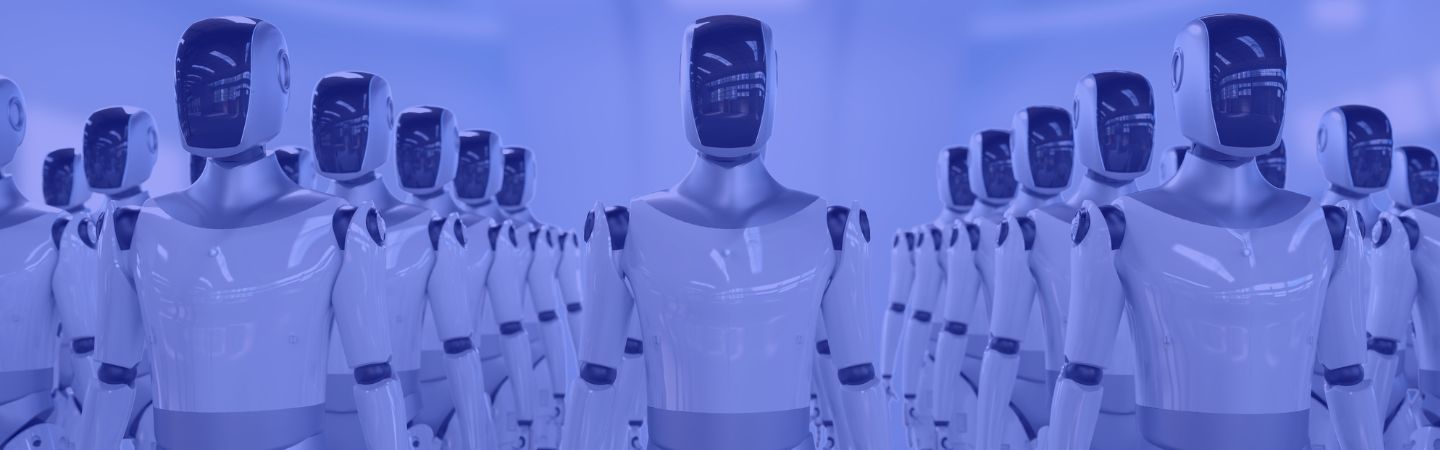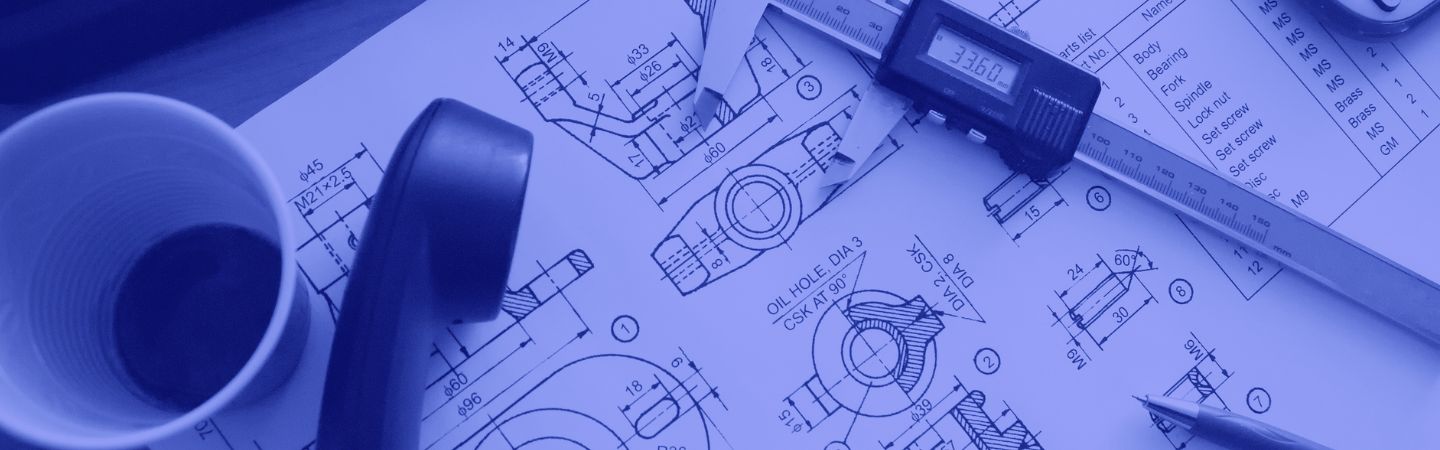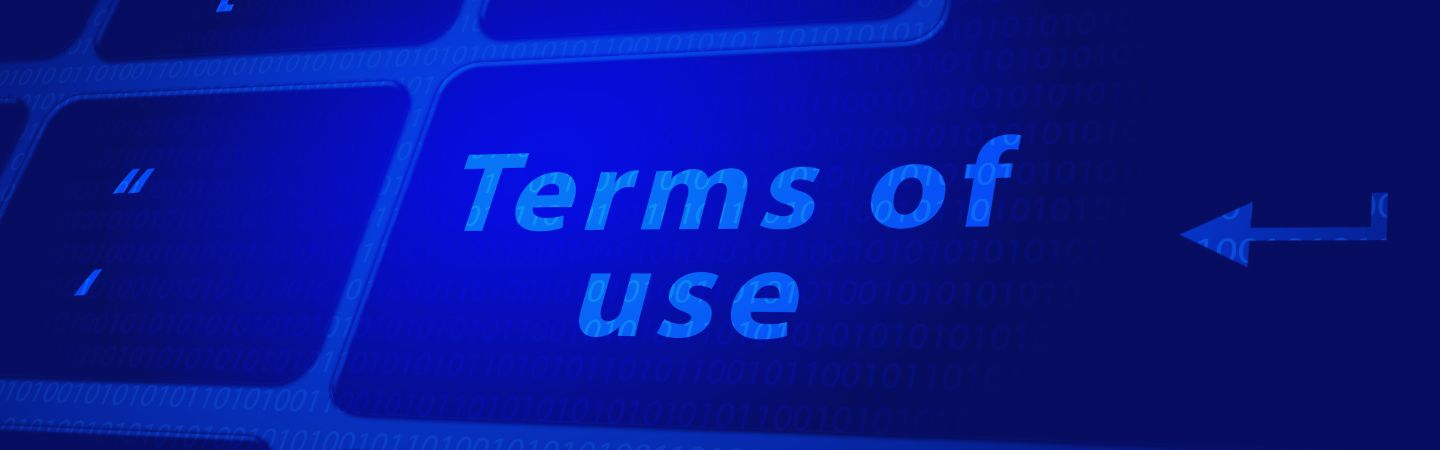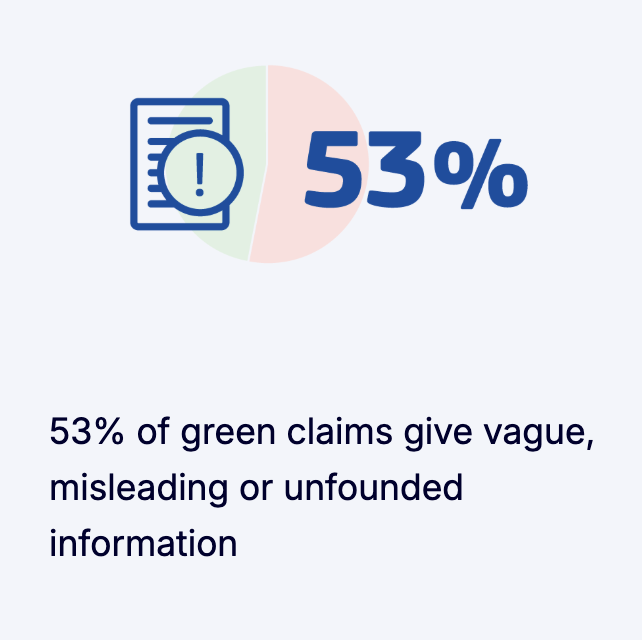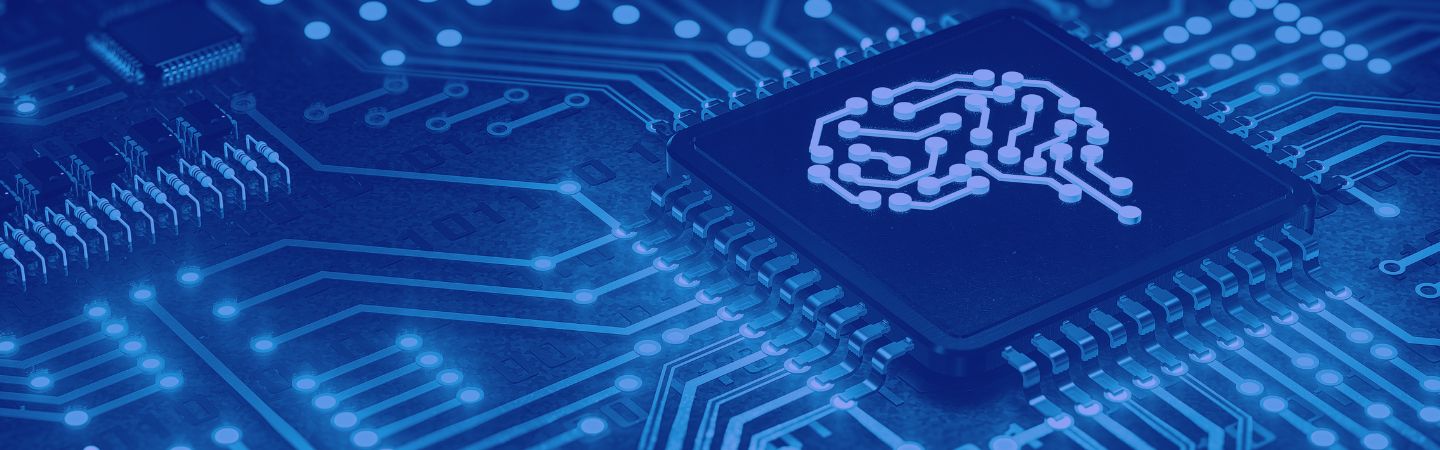Im Juni 2025 hat Polen einen Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Transformation gesetzt und bei der Europäischen Kommission einen offiziellen Antrag auf den Bau einer Gigafabrik für künstliche Intelligenz – der Baltic AI GigaFactory – gestellt. Dieses Projekt mit einem geschätzten Budget von 3 Milliarden Euro ist die bislang größte Investition in die KI-Infrastruktur in Mittelosteuropa. Das Konsortium wird von Polen angeführt und umfasst wichtige Technologieunternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Vertreter der öffentlichen Verwaltung aus Polen, Litauen, Lettland und Estland. Zu den Geschäftspartnern zählen unter anderem Allegro, Orange Polska und CloudFerro, während auf wissenschaftlicher Seite NASK, IDEAS NCBR, Cyfronet, die Universität Vilnius und die Universität Lettlands vertreten sind. Ziel des Projekts ist die Schaffung einer souveränen, offenen und zugänglichen KI-Infrastruktur, die die Entwicklung, das Training und die Implementierung großer KI-Modelle ermöglicht und Mittelosteuropa technologische Unabhängigkeit in Schlüsselbereichen der digitalen Wirtschaft verschafft.

AI-Gigafabrik in Polen – bahnbrechende Investition in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz
Der Antrag zum Bau einer AI-Gigafabrik in Polen ist Teil einer umfassenderen Strategie der Europäischen Union, die die Notwendigkeit erkennt, eigene, unabhängige Rechenressourcen und Kompetenzen im Bereich der künstlichen Intelligenz aufzubauen. In den letzten Jahren haben wir eine dynamische Zunahme der Bedeutung von KI in fast allen Wirtschaftsbereichen beobachtet – von der Industrie über das Gesundheitswesen, das Bildungswesen und die Energiewirtschaft bis hin zur öffentlichen Verwaltung. Polen, ein Land mit großem Entwicklungspotenzial, das jedoch auch mit Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung zu kämpfen hat, hat beschlossen, diesen Moment zu nutzen, um sich als regionaler Marktführer im Bereich KI zu etablieren. Die KI-Gigafabrik soll eine Antwort auf den wachsenden Bedarf an Rechenleistung, Zugang zu modernen Sprachmodellen und Analysewerkzeugen sein, die für innovative Forschung und die Umsetzung fortschrittlicher digitaler Lösungen unerlässlich sind.
Das Projekt Baltic AI GigaFactory sieht vor, dass bis zu 65 % der Investitionsmittel aus privatem Kapital stammen sollen, was das Engagement der Wirtschaft für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in Polen unterstreicht. Der verbleibende Teil der Finanzierung soll aus europäischen Fonds und nationalen Programmen zur Förderung von Innovationen stammen. Die AI-Gigafabrik wird an maximal zwei Standorten in Polen errichtet, die optimale Bedingungen für anspruchsvolle Berechnungen bieten, darunter Zugang zu grüner Energie, geringe Netzwerklatenzen und eine geeignete Telekommunikationsinfrastruktur. Innerhalb weniger Jahre ist eine Erweiterung der Rechenleistung auf 30.000 Grafikprozessoren (GPUs) geplant, was das Training von KI-Modellen mit Billionen von Parametern ermöglichen wird.

Entwicklung von Sprachmodellen und KI-Ökosystemen – Polen und die Region Mittel- und Osteuropa
Eines der Hauptziele der KI-Gigafabrik ist die Förderung der Entwicklung eigener regionaler Sprachmodelle und KI-Tools, die an die sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Besonderheiten Mittelosteuropas angepasst sind. Zu den Vorzeigeprojekten, die im Rahmen der Baltic AI GigaFactory entwickelt werden sollen, gehören die polnischen Sprachmodelle PLLuM und Bielik.AI und das lettische Modell Tilde. Dadurch erhalten Polen und die baltischen Staaten Zugang zu Tools, mit denen sie effektiv mit globalen Technologieriesen konkurrieren können und gleichzeitig die digitale Sicherheit und Souveränität der Region gewährleisten können.
Hervorzuheben ist, dass der Bau einer KI-Gigafabrik in Polen nicht nur eine Frage der Technologie ist, sondern auch einen Impuls für die Entwicklung des gesamten Innovationsökosystems darstellt. Das Projekt sieht eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung vor, was zu einer Zunahme der KI-Implementierungen in strategischen Sektoren wie Gesundheit, Energie, Landwirtschaft, Industrie und Verwaltung führen soll. Dank der Investitionen in die KI-Infrastruktur erhält Polen die Chance, neue ausländische Investitionen anzuziehen, digitale Kompetenzen auszubauen und die Produktivität der Wirtschaft zu steigern. Langfristig soll die KI-Gigafabrik zum Katalysator für die digitale Transformation der gesamten Region werden und die Umsetzung ambitionierter Forschungs- und kommerzieller Projekte auf internationaler Ebene ermöglichen.
Gesetze und Richtlinien zu KI – AI Act und neue Vorschriften für die Gigafabrik
Nicht zu vernachlässigen sind auch rechtliche Fragen, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Einführung künstlicher Intelligenz spielen. Im Juli 2024 hat die Europäische Union mit dem AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689) eine wegweisende Verordnung zur künstlichen Intelligenz verabschiedet, die den weltweit ersten umfassenden Rechtsrahmen für KI schafft. Ziel des AI Act ist es, die Sicherheit und den Schutz der Grundrechte zu gewährleisten und die Entwicklung vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz in der gesamten Union zu fördern. Die Verordnung führt eine vierstufige Risikoklassifizierung für KI-Systeme ein, die Systeme mit unannehmbarem Risiko (die verboten sind), Systeme mit hohem Risiko (z. B. KI in der Justiz, Medizin, kritischen Infrastrukturen), Systeme mit begrenztem Risiko und Systeme mit minimalem Risiko umfasst.
Der AI Act erlegt Anbietern, Importeuren, Vertreibern und Nutzern von KI-Systemen eine Reihe neuer Pflichten auf, darunter die Durchführung von Audits, die technische Dokumentation, die Überwachung der Konformität und die Gewährleistung angemessener Kompetenzen der Mitarbeiter (KI-Kompetenz). Von besonderer Bedeutung sind die Vorschriften für Hochrisikosysteme, die strenge Anforderungen an Sicherheit, Transparenz und Verantwortlichkeit erfüllen müssen. Die Verordnung sieht auch hohe Strafen für Verstöße vor – bis zu 35 Millionen Euro oder 7 % des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens. Die Umsetzung des AI Act erfolgt schrittweise – die ersten Vorschriften gelten ab Februar 2025, weitere treten im August 2025 und 2026 in Kraft.

Auswirkungen des AI Act auf das polnische Recht und die Pflichten für Unternehmen
Im Zusammenhang mit dem Bau einer AI-Gigafabrik in Polen sind neue gesetzliche Regelungen von entscheidender Bedeutung, um die Konformität der geplanten Lösungen mit den EU-Anforderungen sicherzustellen. Derzeit wird an einem nationalen Gesetz über künstliche Intelligenz gearbeitet, das die wirksame Umsetzung des AI Act auf nationaler Ebene ermöglichen soll. Die neuen Vorschriften sollen flexibel, transparent und innovationsfreundlich sein und gleichzeitig die Sicherheit der Bürger und den Schutz ihrer Rechte gewährleisten. Der stellvertretende Minister für Digitalisierung, Dariusz Standerski, betont, dass das Ziel darin besteht, stabile und vorhersehbare rechtliche Lösungen zu schaffen, die die Einführung von KI in polnischen Unternehmen und Institutionen beschleunigen.
Für Unternehmer bedeutet dies, dass sie sich an neue gesetzliche Anforderungen anpassen müssen, darunter die Verpflichtung zur Risikobewertung und zur Führung technischer Unterlagen für risikoreiche KI-Systeme, die Erstellung von Richtlinien für die Einführung von KI, regelmäßige Konformitätsaudits, die Aktualisierung der Technologien und die Sicherstellung entsprechender Kompetenzen der Mitarbeiter im Bereich KI. All dies bedeutet, dass die Einführung von KI in polnischen Unternehmen nicht nur technologische Investitionen, sondern auch den Aufbau rechtlicher und organisatorischer Kompetenzen erfordern wird.
Lesen Sie mehr hier: https://lbplegal.com/co-powinna-zawierac-polityka-wykorzystywania-systemow-ai/
AI-Gigafabrik und rechtliche Herausforderungen – geistiges Eigentum und Haftung
Eine der größten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von KI sind Fragen des Schutzes des geistigen Eigentums sowie der Transparenz und Verantwortung für Entscheidungen, die von KI-Systemen getroffen werden. Dies gilt insbesondere für regulierte Sektoren wie das Gesundheitswesen, das Finanzwesen oder die öffentliche Verwaltung, in denen Fehler oder intransparente Abläufe der KI schwerwiegende rechtliche und gesellschaftliche Folgen haben können. Der AI Act führt die Verpflichtung ein, Entscheidungen von KI-Systemen zu erklären und sicherzustellen, dass Nutzer die Möglichkeit haben, gegen Entscheidungen von Algorithmen Einspruch einzulegen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Vertrauen in künstliche Intelligenz aufzubauen und deren ethische Nutzung zu gewährleisten.
Es ist auch anzumerken, dass die Bestimmungen des AI Act in Polen derzeit „zahnlos” sind, da noch keine Aufsichtsbehörde eingerichtet wurde, die für die Durchsetzung der neuen Vorschriften zuständig wäre. Es wird jedoch an der Einrichtung einer Kommission für die Entwicklung und Sicherheit künstlicher Intelligenz gearbeitet, die den Markt überwachen, die Konformität von KI-Systemen mit den Vorschriften kontrollieren und Strafen für Verstöße verhängen soll. Dies ist ein wichtiger Bestandteil des Aufbaus eines nationalen KI-Ökosystems, das Sicherheit, Transparenz und Verantwortung bei der Entwicklung neuer Technologien gewährleisten soll.

AI-Gigafabrik in der digitalen Entwicklungsstrategie Polens
Der Bau einer KI-Gigafabrik in Polen ist auch Teil einer umfassenderen Strategie zur Entwicklung künstlicher Intelligenz, die sich auf Sektoren mit dem größten wirtschaftlichen Potenzial und die Bewältigung großer sozialer und wirtschaftlicher Herausforderungen konzentriert. Trotz der dynamischen Entwicklung der KI weltweit hat Polen bei der Anpassung dieser Technologie noch Aufholbedarf. Laut einem Bericht des Polnischen Wirtschaftsinstituts ist es notwendig, den technologischen Stack der KI zu analysieren, die Sektoren mit dem größten Potenzial zu identifizieren und ein Innovationsökosystem aufzubauen, das die effektive Umsetzung neuer Lösungen ermöglicht. Die KI-Gigafabrik soll Impulse für die Beschleunigung von Innovationen, die Steigerung der Produktivität und den Aufbau eines Wettbewerbsvorteils für die polnische Wirtschaft geben.
Die Zusammenarbeit mit globalen Technologieführern wie Google und die Entwicklung nationaler Sprachmodelle sind Elemente der Strategie, die Polen einen Platz unter den Führern der digitalen Transformation sichern sollen. Dank Investitionen in die KI-Infrastruktur, die Entwicklung digitaler Kompetenzen und den Aufbau eines offenen Innovationsökosystems hat Polen die Chance, sich zu einem Zentrum für die Entwicklung künstlicher Intelligenz in Mittelosteuropa zu entwickeln. Dies wird wiederum zu einer Zunahme der KI-Implementierungen in strategischen Sektoren, zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und zur Steigerung der Attraktivität des Landes für ausländische Investoren führen.
Digitale Kompetenzen und Sicherheit – die Rolle der KI-Gigafabrik für Polen
Die KI-Gigafabrik ist auch eine Chance für die Entwicklung digitaler Kompetenzen bei polnischen Arbeitnehmern und Wissenschaftlern. Das Projekt sieht eine enge Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen vor, um neue Fachkräfte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Datenwissenschaft und Datenengineering auszubilden. Dadurch erhält Polen Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften, die innovative Projekte auf internationaler Ebene realisieren können. Langfristig wird sich die Investition in digitale Kompetenzen in einer Steigerung der Innovationskraft der Wirtschaft und einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit polnischer Unternehmen auf dem globalen Markt niederschlagen.
Nicht zu vergessen ist die Rolle der KI-Gigafabrik für den Aufbau der digitalen Souveränität Polens und der Region. In Zeiten wachsender Cyber-Bedrohungen und geopolitischer Spannungen wird eine eigene, unabhängige KI-Infrastruktur zu einem wesentlichen Bestandteil der nationalen Sicherheit. Die KI-Gigafabrik wird die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen ermöglichen, die mit den europäischen Werten und Standards im Einklang stehen und gleichzeitig den Schutz personenbezogener Daten, der Privatsphäre und der Rechte der Bürger gewährleisten. Dies ist besonders wichtig angesichts der wachsenden Bedeutung der KI in Bereichen wie Verteidigung, Sicherheit, Gesundheit und öffentliche Verwaltung.

AI-Gigafabrik – Entscheidungen, Richtlinien und die Zukunft der künstlichen Intelligenz in Polen
Der Bau einer Gigafabrik für künstliche Intelligenz in Polen ist eine Investition von strategischer Bedeutung für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft, Innovation und Sicherheit des Landes. Dank der Umsetzung dieses Projekts erhält Polen die Chance, eine eigene, souveräne KI-Infrastruktur aufzubauen, digitale Kompetenzen zu entwickeln und seine Position auf internationaler Ebene zu stärken. Von entscheidender Bedeutung sind dabei der neue Rechtsrahmen – der AI Act, nationale Vorschriften, Regierungsbeschlüsse und die internationale Zusammenarbeit, die eine sichere, innovative und ethische Entwicklung der künstlichen Intelligenz gewährleisten sollen. Die KI-Gigafabrik ist nicht nur eine Technologie, sondern auch ein Impuls für den Aufbau eines modernen Innovationsökosystems, das es Polen und der Region ermöglicht, auf dem globalen digitalen Markt erfolgreich zu konkurrieren. In den kommenden Jahren werden gerade die Entscheidungen über den Ausbau der KI-Infrastruktur, die Umsetzung neuer Richtlinien und den Aufbau digitaler Kompetenzen über die Zukunft der polnischen Wirtschaft und ihre Position in Europa entscheiden.
Es lohnt sich, die weitere Entwicklung des Projekts Baltic AI GigaFactory zu beobachten, da seine Umsetzung nicht nur für Polen, sondern für ganz Mittelosteuropa einen Durchbruch bedeuten könnte. Gemeinsame Maßnahmen der Länder der Region, die Unterstützung der Europäischen Kommission und das Engagement des privaten Sektors sind Faktoren, die über den Erfolg dieser Investition entscheiden können.